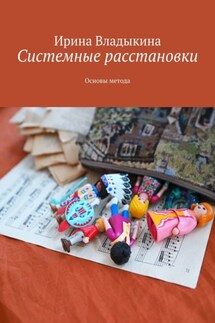Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Т. 15. Революция и эволюция в немецкоязычных литературах - страница 2
In der Geschichte beider Begriffe fällt auf, dass ‚Revolution‘ wie ‚Evolution‘ ihre modernen Begriffsinhalte im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erhalten, also in der Phase, die die Bielefelder Historikerschule um Reinhart Koselleck als die „Sattelzeit“ um 1800 beschrieben hat, in der vormoderne in moderne Gesellschaftsformen übergehen. Die Modernität beider Begriffe – und das ist entscheidend – stellt sich aber ganz unterschiedlich dar. ‚Revolution‘ ist insofern wahrhaft modern, als der Begriff eigentlich eine Leerstelle bezeichnet, die dort entsteht, wo alte metaphysisch-ontologische Deutungsschemata nicht mehr greifen. Das Erdbeben von Lissabon 1755 war noch metaphysisch-theologisch interpretierbar gewesen, ja das Ereignis befeuerte geradezu die philosophische Diskussion: Die Theodizee-Frage wurde neu diskutiert; Voltaire verspottete Leibniz und sein Theorem der „besten aller möglichen Welten“; Rousseau und Voltaire stritten über den Optimismus et cetera. Die Französische Revolution hingegen fand statt am Ende des Jahrhunderts der Aufklärung, das fortwährend Metaphysikkritik unter dem Label der Vorurteilskritik betrieben hatte. Die sich brachial in der Tagespolitik entladende Gewalt war 1789 weder in die theologische Providentia-Lehre, also in den weisen Plan Gottes, noch in ein geschichtsphilosophisches Fortschritts- oder Perfektibilitätsmodell zu integrieren. Im Gegenteil: Geschichtsphilosophie musste erst neu erfunden oder vom idealistischen Kopf auf die materialistischen Füße gestellt werden, um Revolutionen sinnstiftend in eine neue metaphysische Ersatzreligion integrieren zu können. Zusammenfassend: Im Umfeld von 1789 meinte ‚Revolution‘ das aus jeder Ordnung Herausfallende, sich jeder Sinnstiftung Entziehende – und war in diesem Sinne geradezu dekonstruktivistisch modern.
‚Evolution‘ hingegen gehört zu jenen in der Sattelzeit neu entstehenden Begriffen, die die Last der metaphysisch-ontologischen Tradition, die man eigentlich abwerfen wollte, in einem modernen Begriffsdesign fortschrieben. ‚Entwicklung‘ und ‚Entfaltung‘ sind ohne metaphysische Fundamentalannahmen gar nicht denkbar. Was sich entwickeln, entfalten soll, muss der Essenz nach bereits wesenhaft vorhanden sein, wie Sartre gesagt hätte. Das gilt für den Samen der Pflanze wie für die Individualität des Individuums. Der Keim trägt bereits das Programm, nur blendet die Moderne die alten Fragen aus, wer dieses Programm dort eingeschrieben hat und zu welchem Zweck, nach welchem Plan.
Im Bereich der Geschichtsphilosophie lässt sich kurz zeigen, dass mit der Wahl zwischen den Prinzipien von ‚Revolution‘ und ‚Evolution‘ auch in der Moderne gänzlich unterschiedliche Weltzugänge oder Weltdeutungsmuster verbunden sind. Wir wenden uns zur Verdeutlichung Goethe zu:
es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen [Goethe 1987, I/33: 315].
Zuletzt hat Gustav Seibt [2014] in seinem Buch Goethe in der Revolution alle historischen Bezüge entfaltet, die diesem berühmten Diktum aus Goethes Belagerung von Mainz eingeschrieben sind. Genau betrachtet, betrifft jedoch vor allem der erste Teil, das Begehen einer Ungerechtigkeit, die Sphäre des Geschichtlichen oder Politischen, die Goethe als nicht mehr steuerbaren Ausbruch von Partikularinteressen, als Wüten individueller Egoismen und demagogisch verführter Köpfe auffasste; dort konnte, ja musste „Ungerechtigkeit“ geschehen. Der zweite Teil aber, die Nichtanerkennung von „Unordnung“, meint hingegen das Übergeschichtliche, die alles durchdringende Ordnungsstruktur der Welt oder der „Natur“, deren gesicherte Existenz Goethe unter gar keinen Umständen ableugnen wollte.